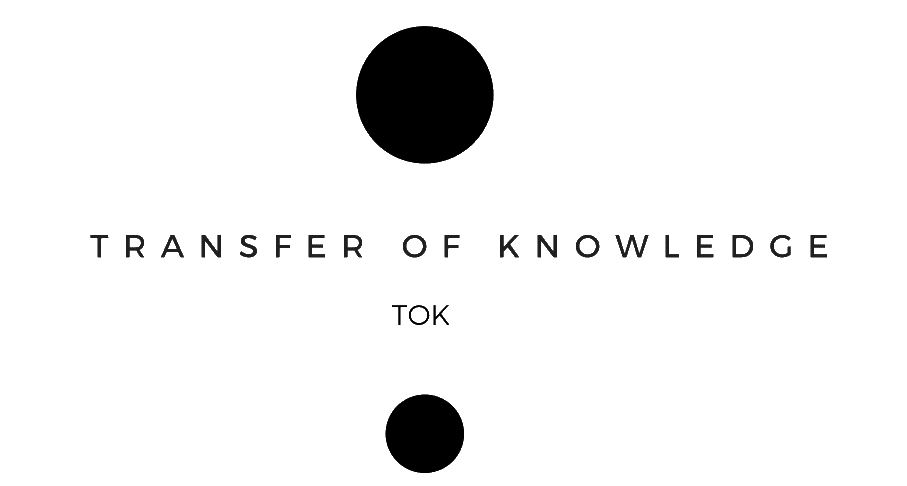Integration und Assimilation
Als klassisches Zuwanderungsland steht Deutschland schon länger Integrationsfragen gegenüber. Immer wieder wird in Medien und Politik darüber debattiert, wie Zugewanderte in die Kultur eingegliedert werden sollen und welche Maßnahmen wohl den größten Erfolg brächten. Auch die Migrationsforschung beschäftigt sich immer wieder mit den vielen Fragen, die diese Kulturzusammenkünfte aufwerfen.
Während dieser Diskurse kommt es im Alltagsgebrauch immer wieder zu Begriffsproblematiken, die auf eine Unkenntnis der Lebensrealitäten der zugewanderten Menschen hindeuten. Dabei spielt die Differenzierung zwischen Integration und Assimilation eine ganz entscheidende Rolle.
Die Assimilation beschreibt die Angleichung von Etwas an etwas Anderem. In der Soziologie wird damit die Anpassung/Angleichung einer Gruppe gegenüber einer anderen – meistens der Mehrheitsgesellschaft – gemeint. Die Individuen der Gruppe werden angepasst oder müssen sich proaktiv so weit anpassen, bis keine relevanten Unterschiede mehr vorhanden sind. Das bedeutet, dass das Endergebnis einer erfolgreichen Assimilation zwangsläufig eine homogene Masse schafft. Die Anpassung vollzieht sich meistens auf kultureller Ebene, wenn es um Sitten und Bräuche sowie Wertvorstellungen (bspw. Religionen) geht, kann sich allerdings auch auf Äußerlichkeiten (bspw. Afrohaar, Kopftuch) beziehen. Dabei wird das Individuum dadurch „gezwungen“ sich anzupassen, dass es nur so das Gefühl von Zugehörigkeit und Teilhabe erfährt oder sich so vor Diskriminierung schützt.
Bei der Integration handelt es sich um einen Prozess, das sich über eine längere Zeit als ein ganzheitliches Bewegen der Gesellschaft kennzeichnet. Nicht nur der zugewanderte Mensch passt sich seiner Umgebung an, auch die Umgebung bewegt sich ihm entgegen. Es wird eine Eingliederung in ein bestehendes System angestrebt, in dem Differenzen harmonisch Platz haben. Das führt im Endeffekt zu einer heterogenen, man könnte sagen, bunten Masse.
Bei der Integration handelt es sich dementsprechend um einen Prozess, in dem sich Zugewanderte langsam in ihre Aufnahmegesellschaft eingliedern und dabei ihre eigene Kultur weiterhin wertschätzen und einbringen. Im Klartext vernichtet Assimilierung also Multikulturalität und erzwingt Identitätsverlust beim Individuum. Integration hingegen öffnet den Raum für kulturellen Pluralismus. Eine solche inklusive Gesellschaft ist offen, divers und zeichnet sich durch ein hohes Maß an individueller Freiheit aus.
Nehmen wir das Beispiel Sprache. Beim Zuzug in ein neues Land ist es von Vorteil sich die Sprache des Landes anzueignen. Diese Tatsache kann sowohl vom Land selbst als auch vom zugezogenen Menschen akzeptiert werden. Es bringt Vorteile und erleichtert die Kommunikation um Längen. Es bedeutet allerdings nicht, dass Migrant*innen ihre Muttersprache ablegen müssen oder ihnen gar ein Verbot der Nutzung ihrer Muttersprache auferlegt werden sollte. Letzteres wäre ein Versuch der Unterdrückung von Identität und Unterschied. Die Ausgrenzung oder Verachtung aufgrund des Sprechens einer bestimmten Sprache kann dazu führen, dass eine Person sich dafür entscheidet diesen Teil ihrer Identität zu verleugnen – auch das wäre erzwungene Anpassung durch Druck von Außen. Klassische Assimilationspolitik.
Nach der Ausführung mag klar sein, dass die Integration für unser modernes Verständnis von Kultur und Humanität bevorzugt werden sollte. Und doch kommt es genau hier zu Problemen. Die Eingliederung fremder Kulturen führt immer wieder zu Spannungsfeldern. Es ist im Integrationsprozess im Vergleich zur Assimilation viel mehr Diskussionsbedarf vorhanden. Themen müssen angesprochen und gelöst werden und Lösungen dürfen nicht in Stein gemeißelt sein. Diese Art von Unstetigkeit hat auf Dauer Konfliktpotenzial. Nicht immer sind die realen Probleme so klar und leicht zugänglich, wie das Sprachenbeispiel. Umso wichtiger ist es also, dass wir die Spannungsfelder benennen und Kommunikation dort herstellen, wo sie benötigt wird. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe liegt darin, zu erkennen, wann und wo Integration und wann/wo schon Assimilation betrieben wird.
Mit TOK schaffen wir ein Kommunikationsfeld für Migrantinnen und geflüchtete Frauen zum Thema Bildung und Soziales. Unser Team besteht zum Großteil aus Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte, deshalb können wir mit unseren eigenen Erfahrungen zugewanderten Frauen Orientierung bieten und die Integration erleichtern. Ein weiteres Ziel ist die Gesellschaft für den Prozess der Integration zu sensibilisieren und auf vermeidliche Assimilierungspolitik hinzuweisen. Wir wollen ein buntes Deutschland!